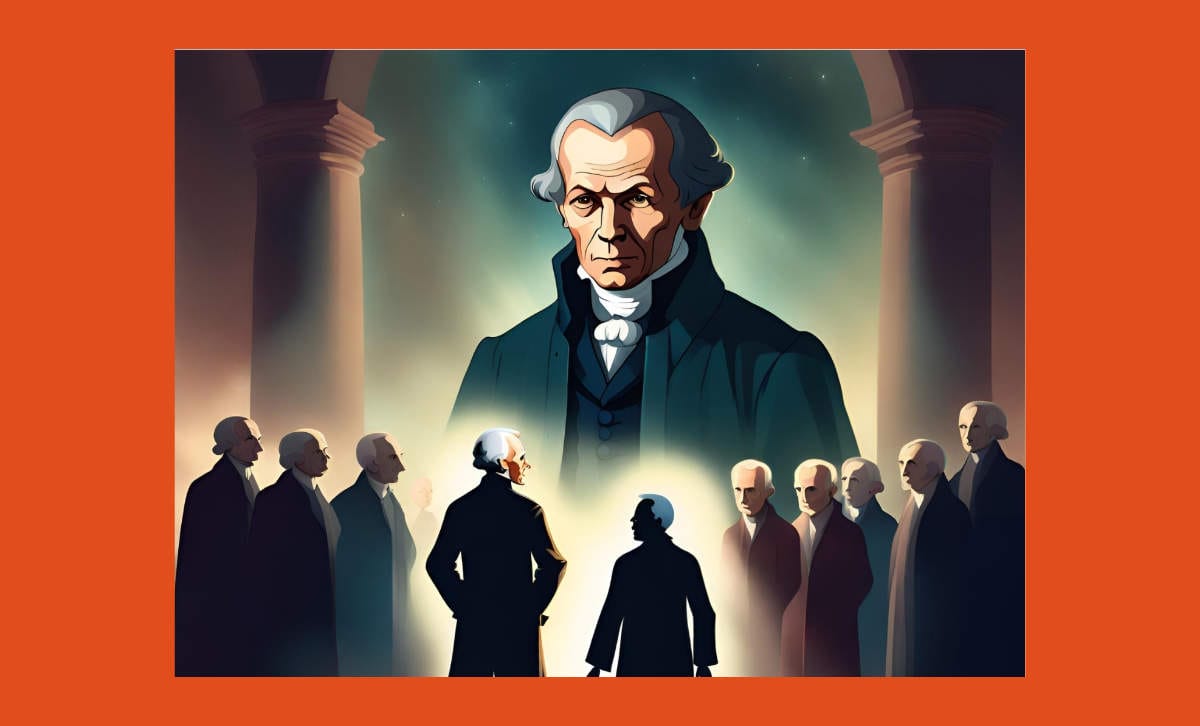Der gebrochene Damm
Lange habe ich hin- und herüberlegt, ob ich mich daran beteilige:
Immanuel Kant, der philosophische Autor, mit dessen Werken ich mich irgendwann intensiv beschäftigen musste, wird in diesem Jahr anlässlich seiner Geburt vor 300 Jahren – am 22. April 1724 – „Auflagen-erheischend“ gefeiert: Die Welle von Buch-Publikationen, Magazin-Sonderausgaben und Feuilleton-Artikeln in deutschen Zeitungen steigt kontinuierlich an und „ersäuft“ zunehmend das Interesse am Thema.
Doch nachdem ich in den letzten Tagen sehen musste, wie dem Königsberger allerlei „Weithergeholtes“ angedichtet wird, etwa mit seiner spätaufklärerischem Philosophie begänne „die Moderne“, es enthielte die wesentlichen Lösungen für aktuelle politische Krisen und ein gewisser Pegelhöchststand: sein Werk enthalte Hilfe gegen unsere Depressionen anlässlich schwerer Zeiten, brach für mich ein Damm.

Bevor in den nächsten Tagen jemand behauptet, Kants Kritiken bekämpften Hämorriden, Warzen oder Liebeskummer, schreibe ich geschwind etwas – auch wenn es kaum leichtgewichtig genug ist, um oben auf der Publikations-Welle zu „surfen“.
Warum ich mich provozieren lasse? Meinem Entschluss liegt eine persönliche Verpflichtetheit zu Grunde. Zwar hatte sich bei beim weit zurückliegenden Soziologie-, Psychologie- und Philosophie-Studium eher durch Zufall die Chance ergeben, die Argumentation in Kants Kritiken „herauszupräparieren“ und daran anknüpfend wissenschaftstheoretisches Know-how aufzubauen. Aber dieses „Kantwissen“ verhalf mir nacheinander zu einer gelungenen Hauptseminararbeit, zu einer Magister-Arbeit, einer Dissertation, zu bestandenen mündlichen Prüfungen sowie zu einem insgesamt zügigen Studienabschluss.
Dem Denker aus der heutigen russischen Exklave Kaliningrad bin ich also verpflichtet, auch wenn ich dem zustimme, was Heinrich Heine schrieb und eine faktenbasierte Diskussion des kritischen Werks so schwierig macht: „Die Lebensgeschichte des Immanuel Kant ist schwer zu beschreiben. Denn er hatte weder Leben noch Geschichte.“ (2)
Am Ende sind wir alle Kantianer!
Obwohl Kants Person, wie Heine andeutet, eine gewisse „Unscheinbarkeit“ anhaftet, ist „unser Geburtstagskind“ seit vielen Jahrzehnten zu einem historischen öffentlichen „deutschen Intellektuellen“ stilisiert und durch kulturelle Bewertung auf eine hohe, eine Spitzen-Position versetzt worden.

Bildungsbürger identifizieren sich in unserem Land mit Philosophie als einer gleichermaßen nationalen wie kosmopolitischen Domäne. Und ausgerechnet „unser Kant“ bekommt hier die beherrschende intellektuelle Führungsrolle zugebilligt – alles Denken vor und nach ihm stehe in seinem Schatten oder sei ihm zumindest verpflichtet.
Das hört sich übertrieben an, trifft die Sache aber dennoch: Beispielsweise Heidegger schrieb ein komplettes Buch mit seiner Interpretation von Details der transzendentalen Deduktion in Kants Vernunftkritik. Adorno hielt eine kürzlich bei Suhrkamp veröffentlichte vollständige Vorlesung über Kants erste Kritik, diskutierte ausgiebig in seinem Hauptwerk „Negative Dialektik“ Kants Konzept des „intelligiblen Charakters“. Adornos einstiger Assistent Habermas erwähnt in seinem Alterswerk, einer zweibändigen „Art Geschichte der Philosophie“ auf ca. 1.600 Seiten Kant 717 mal (Hegel kommt nur auf 645, Marx gerade einmal auf 264, Schelling – über den der Denker aus dem Bergischen promovierte – nur auf 34, Holbach – einer der einflussreichsten Autoren der europäischen Aufklärung – auf 3 recht kurze Erwähnungen).
Übrigens: Hannah Arendt, deren Vorfahren aus der „Kant-Stadt“ Königsberg stammten, studierte die Kritik der reinen Vernunft, die auf dem Buchregal der Eltern stand, bereits als Jugendliche.
Wer Deutschland als ausgesprochene Kulturnation schätzen und seinen Vertretern gerecht werden möchte, kommt an Kant nicht vorbei. – So hieß es in Wladimir Putins Rede vor dem Deutschen Bundestag am 25. September 2001 einschmeichlerisch und unter Beifall der Anwesenden: „Heute erlaube ich mir die Kühnheit, einen großen Teil meiner Ansprache in der Sprache von Goethe, Schiller und Kant, in der deutschen Sprache, zu halten.“ – (Nicht vergessen: Die genannten beiden bekanntesten deutschen Dichter waren als Verehrer insbesondere der Kritik der Urteilskraft so etwas wie Kant-Schüler …)
„Öffentliche“ Philosophien tendieren dazu, öffentliche Legenden zu werden.
Jetzt kommen wir zu den Folgen, die solche überwältigende öffentliche Würdigung für die Diskussion eines philosophischen Werks und seines Urhebers hat. – Frage: Wie wird die Sicht auf den Autoren der betreffenden Philosophie verändert? Kann seine Philosophie diese Öffentlichkeitswirkung überstehen?
Denn: Ein breites Publikum verbindet mit einer „bekannten“ Philosophie die Vorstellung von einem „konsumierbaren“ Kulturgut, das ein Weltbild und einen „originellen“ Deutungsansatz zur Betrachtung der menschlichen Existenz liefern soll.
Im Einzelnen ist für die Nachvollziehbarkeit der jeweiligen öffentlich beachteten Philosophie wesentlich, dass das dahintersteckende Denk-Konzept sich in die verbreiteten Denk-Traditionen der betroffenen Bevölkerungsgruppe einfügt und in diesem Rahmen – in diesem „Frame“ – Sinn ergibt.

Der Sinn kann darin bestehen, dass die betreffende Philosophie Antworten zu vertrauten Lebensfragen gibt. Dadurch soll es Erklärungen für existentielle Fragen liefern – etwa nach dem Ursprung des menschlichen Lebens, nach ethischen Begründungen umstrittenen Verhaltens usw. – und alternative Haltungen gegenüber verbreiteten Lebenskonzepten entwerfen.
Nun wird es problematisch: Wird eine Philosophie als Sinnvermittlungs-Ressource betrachtet, zeigt sich mehr oder weniger deutlich, dass es erfahrungsgemäß keineswegs werkgetreue Konzepte aus den Original-Werken sind, die in der Diskussion des Publikums eine Rolle spielen.
Stattdessen werden die Namen von Philosophien und Namen von deren Urhebern sowie ausgewählte Begriffe aus dem jeweiligen Werk herausgegriffen und umfassend mit werkfremden Vorstellungen und Ideen in Verbindung gebracht. Öffentliche philosophische Kulturgüter sind Bildungs-Inhalte, die als argumentative Schablonen – als „mindware“ – dienen, als Träger für eigene Gedanken oder eigene Emotionen oder als argumentative Ressourcen, deren Überzeugungskraft für eigene Gedankengänge »ausgeliehen« werden.
Für genau diesen Vorgang ist das Werk unseres Geburtstagskinds – dabei insbesondere seine Kritik der reinen Vernunft (3) – ein anschauliches und gut belegtes Beispiel.
„Alle Erkenntnis ist unsicher!“
Für die breite Öffentlichkeit werden seit langem aus dem verwinkelten Konzept der Vernunftkritik allerlei simple Botschaften abgeleitet.
getAbstract ist ein Online-gestützter Dienst, der Bücher populär und publik macht, indem er zu Fachbüchern nach einem einheitlichen Raster Abstracts – Zusammenfassungen – veröffentlicht.
Auch an Kants Werk hat sich getAbstract „versucht“ – hier findet sich eine Bearbeitung der Kritik der reinen Vernunft, die mit einer Auswahl öffentlich verbreiteter Interpretationen von Kants Argumentation arbeitet (4). Im betreffenden Abstract wird behauptet »Immanuel Kant hat mit der Kritik der reinen Vernunft eine Revolution ausgelöst. (…) Der Königsberger Philosoph untersucht die Grundlagen unserer Erkenntnisfähigkeit und kommt zum Schluss, dass diese begrenzt ist.«
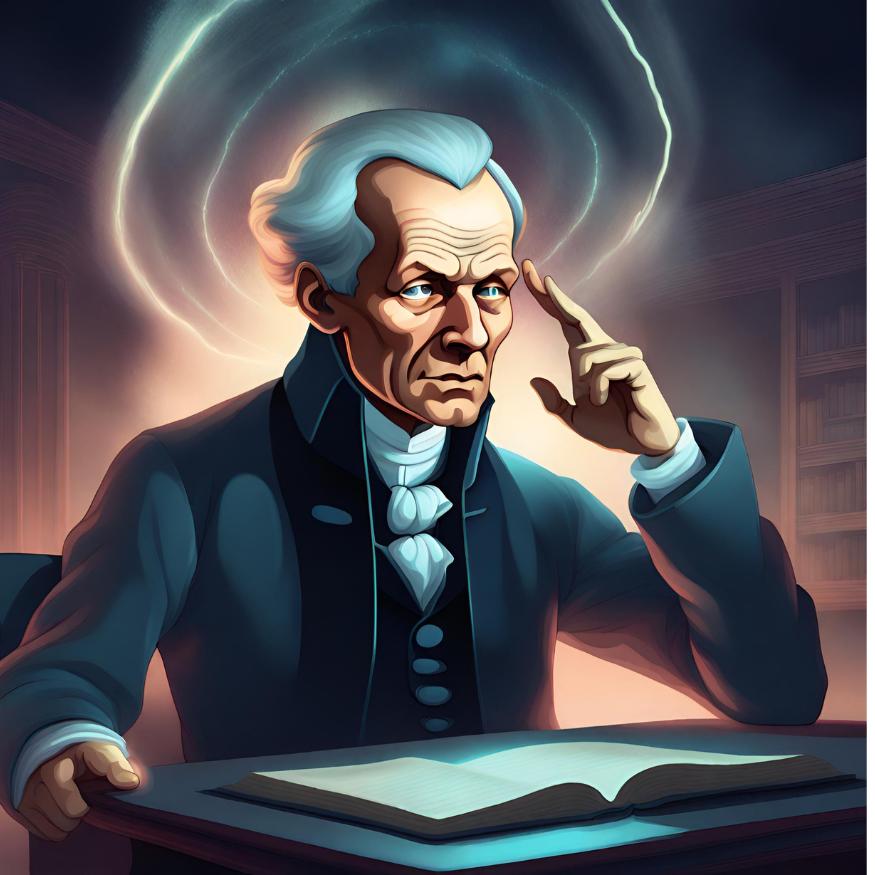
Was ist von dieser Auslegung zu halten? – Da Kant die meiste Zeit seines Lebens in Königsberg gelebt hat, ist es naheliegend, ihn als »Königsberger« Philosophen zu bezeichnen. Der Rest der Deutung von getAbstract – Kant wäre der Vordenker einer Art konstruktivistischer Skeptik an wissenschaftlicher Gewissheit sowie ein Erkenntnis-Bezweifler gewesen – hat kaum etwas mit Kant und dessen Intentionen zu tun.
Ihm ging es stattdessen darum, auf der Basis seiner drei Kritiken die aus seiner Sicht für die menschliche Ethik antinomische – durch Widersprüche bewirkte – Verwirrtheit des Denkens rund um das unverzichtbare Konzept der „Freiheit des Menschen“ endgültig zu beheben.Entsprechend bringt Kant die Intention der Kritik der reinen Vernunft in einem Brief an Christian Garve vom 21.9.1798 auf den Punkt: „ … die Antinomie der r. V.: ‚Die Welt hat einen Anfang – sie hat keinen Anfang etc. bis zur vierten: Es ist Freiheit im Menschen – gegen den: es ist keine Freiheit, sondern alles ist Naturnotwendigkeit‘; diese war es, welche mich aus dem dogmatischen Schlummer zuerst aufweckte und zur Kritik der reinen Vernunft selbst hintrieb, um das Skandal des scheinbaren Widerspruchs der Vernunft mit ihr selbst zu heben.“ (5).
Kant ging es in der Vernunftkritik vor allem um die zweifelsfreie Absicherung von Vernunft-Einsichten. Sein Ziel war Skandal-Bekämpfung und nicht, durch das Säen von Zweifel selbst wiederum ein Skandal-Autor zu werden, wie sich das der von getAbstract beauftragte Autor vorstellt.
„Naturwissenschaftliches Wissen auf ein festes Fundament stellen …“
Eine weitere „folkloristische“ Deutung der Kritik der reinen Vernunft geht in eine vollständig andere Richtung. So ist es populär, zu behaupten, Kants Absicht wäre es in der Vernunftkritik gewesen, durch das berühmte Konzept »synthetischer Sätze a priori« naturwissenschaftliche Empirie und empirische Gesetze zu rechtfertigen und deren Geltung zweifelsfrei zu sichern. Kant-Rezipienten weisen regelmäßig darauf hin, dass es sich hierbei um eine Fehlinterpretation der Kritik handelt (6).
Kant hatte stattdessen versucht, ein Modell unseres „Erkenntnis-Apparates“ zu entwerfen und damit die allgemeinsten „Bedingungen möglicher Erfahrungen“ zu diskutieren. Sein Thema sind Denkvorgänge, die wir heute als „Metakognitionen“ bezeichnen können; die Kritik ist kein Physik-Buch oder gar der Entwurf einer Natur-Philosophie. Die Deutung, Kant hätte in der Kritik einen Weg gesucht und gefunden, empirische Gesetzmäßigkeiten zu begründen und die Newtonsche Naturwissenschaft zu beweisen, klingt beeindruckend – geht aber am Text von Kants Werk vorbei.
Lebenshilfe durch moralischen Kompass – Kant als Schutzpatron
Leserinnen und Lesern wird es nach den letzten beiden Absätzen aufgrund der Nennung von Details der Kritik der reinen Vernunft möglicherweise zunehmend „mulmig“ zu mute. Keine Angst – im Weiteren dieses Beitrags wird es nicht mehr so tief in Werkdetails gehen. Wir wechseln dazu den Fokus und vergegenwärtigen uns, dass es für „öffentliche Philosophien“ typisch ist, Individuen „profunde“ und pragmatisch anwendbare Lebenshilfe zu bieten.

Ein prominentes Beispiel, an dem ablesbar wird, wie das konkret im Zusammenhang mit Kant funktioniert, ist die kurz vor dessen Tod erschienene Autobiografie des ehemaligen Kanzlers und Regierungschefs der Bundesrepublik Deutschland Helmut Schmidt. Dem Altkanzler wurden im Lauf seines Lebens 24 Ehrendoktorwürden beispielsweise der Universitäten von Oxford, von Cambridge, der Sorbonne, der Harvard University und von der Johns Hopkins University verliehen. – Er ist offenbar ein intellektuelles „Schwergewicht“ mit Vorbild-Charakter.
Der spätere Kanzler der Bundesrepublik war als junger Mann während des Dritten Reichs frühzeitig zum Wehrdienst verpflichtet und teilweise zur Ostfront kommandiert gewesen – eine Erfahrung, die er bis zum Lebensende als belastend empfand.
Weiterer Hintergrund – er engagierte sich für kritischen Rationalismus: Im Jahr 1980 lernte er den Philosophen Karl Popper persönlich kennen, dessen „Die Feinde der offenen Gesellschaft“ er zuvor gelesen hatte, und mit dem er bis zu dessen Tod im Jahr 1994 befreundet war.
Schmidt beschreibt in seiner Autobiografie, dass er sich nach dem Krieg der Philosophie Kants zuwandte, um sich insbesondere in Situationen der politischen Unsicherheit neu auszurichten: „In dem moralischen Chaos, das die Nazis hinterlassen hatten, wurde mir Kant zu einem verlässlichen Kompass.“ (Schmidt 2015) Kants Philosophie war Lebenshilfe, indem Schmidt – wie er es konkret beschreibt – einige „Kantische“ Aussagen in seinem Bewusstsein verankerte. So orientierte er sich an dem Satz: „Moralisches Handeln muss auf Vernunft gegründet sein.“, ohne dabei für sich in Anspruch zu nehmen, diese – recht allgemeine – Aussage aus Textstellen in Kants Werk direkt abzuleiten.
Schmidt schätzte diesen Gedanken, weil er ihm nach eigener Einschätzung half, in bewegten Entscheidungs-Situationen innezuhalten und zu überlegten Handlungslösungen zu kommen.
Kein massenmedialer „Stein der Weisen“
Diese Beispiele zeigen, wie die „Rezeption“ eines philosophischen Werks und ihre Verwandlung in eine „öffentliche Philosophie“ genutzt wird, um unterschiedlichste Dinge zu tun. Wie gesehen, wurde in Kants Vernunftkritik eine trendige Skepsis in Bezug auf die vermeintliche Allmacht modernen Wissens „hineingelesen“. Genauso wird mehr oder weniger das genaue Gegenteil bezweckt, wenn behauptet wird, die Vernunftkritik untermauere die Gewissheit empirisch-wissenschaftlicher Gesetze. Und Individuen glauben, bei Kant moralische Regeln zu erkennen, die ihnen als eine Art Verhaltens-Kompass dienen.
Deutlich ist, dass kaum jemand, der aus Kants „öffentlicher Philosophie“ in der einen oder anderen Richtung Nutzen zieht, jemals selbst in der betreffenden Kritik gelesen hat.
Um die Vernunftkritik herum hat sich offenbar eine „öffentliche Legende“ gebildet, die mit dem Inhalt des Originalwerks wenig gemein hat. Das Schicksal dieser Form der Idealisierung teilen mit großer Wahrscheinlichkeit viele philosophische Werke, die breite Aufmerksamkeit erlangen.
Philosophieren funktioniert nicht als massenmedial wirkender „Stein der Weisen“. Die werkgetreue Vermittlung fachlicher Details ist in der Öffentlichkeit angesichts der dafür erforderlichen hohen Expertise höchst unwahrscheinlich. Was im günstigsten Fall von einem öffentlich gemachten philosophischen Werk übrigbleibt, ist ein gewisser positiver Eindruck, der bei Individuen ausgelöst wird und der sie motivieren kann, sich irgendwann einmal ernsthaft mit einem philosophischen Werk auseinanderzusetzen. Ihr Detailstudium könnte ihnen eröffnen, was der jeweilige Autor konkret geschrieben hat. Wenn aufgrund der derzeitigen Geburtstags-Euphorie viele Personen anfangen, sich ernsthaft mit Kant zu beschäftigen, wäre das eine bemerkenswerte und für die akademische Philosophie erfreuliche Wirkung …
Copyrights Bilder
Die Bilder wurden per Künstlicher Intelligenz mit dem Online-Grafik-Service Canva.com erstellt. Im Detail liegen den Darstellungen keine Portrait-Bilder Immanuel Kants zugrunde o.ä. Es handelt sich bei allem um freie AI-„Fantasie“.
Anmerkungen und Quellen
- Hermann Cohen, Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1885 (Ausgabe 2), S. VII
- Heinrich Heine, Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, Vollständiger, durchgesehener Neusatz mit einer Biographie des Autors bearbeitet und eingerichtet von Michael Holzinger, S. 259
- Immanuel Kant (A1781/B1787), Kritik der reinen Vernunft, Hamburg: Meiner Verlag 1976)
- getAbstract, Kritik der reinen Vernunft, Luzern, getAbstract.com 2004
- Immanuel Kant, Briefwechsel, Hamburg: Meiner Verlag 1972 Seiten 779-80
- vgl.
Hoppe, H., Kants Theorie der Physik, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann 1969, S. 7;
Droste, H. W, Die methodologischen Grundlagen der soziologischen Handlungstheorie Talcott Parsons‘, Dissertation, Düsseldorf: Heinrich-Heine-Universität 1985, S. 14 - Helmut Schmidt, Was ich noch sagen wollte, München: Beck-Verlag 2015